Im Rahmen des Buchclubs des Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea haben sich unsere Mitglieder zu einem Gespräch über das Buch „Das geraubte Leben des Waisen Jun Do“ von Adam Johnson getroffen. Michelle Hillmann – unterstützt von der AG Themen & Politik – reflektiert über ihre Begegnung mit diesem eindrucksvollen Werk.
(von Michelle Hillmann)
Bürger und Bürgerinnen, egal wo ihr gerade rechtschaffene Arbeit verrichtet, versammelt euch um eure digitalen Endgeräte, denn wir haben eine wichtige Buchrezension für euch! Natürlich solltet ihr eure Arbeit niemals für zeitverschwendendes Amüsement, das wertvolle Erträge und Errungenschaften kosten könnte, niederlegen. Doch diese Rezension ist der Inbegriff von Leistungssteigerung und nachdem ihr sie gelesen habt, werdet ihr mit kräftig eingeheiztem Tatendrang doppelt so effizient eure Arbeit verrichten können. Also lest, so dass sich euer diesjähriges Planziel bereits morgen erfüllt!
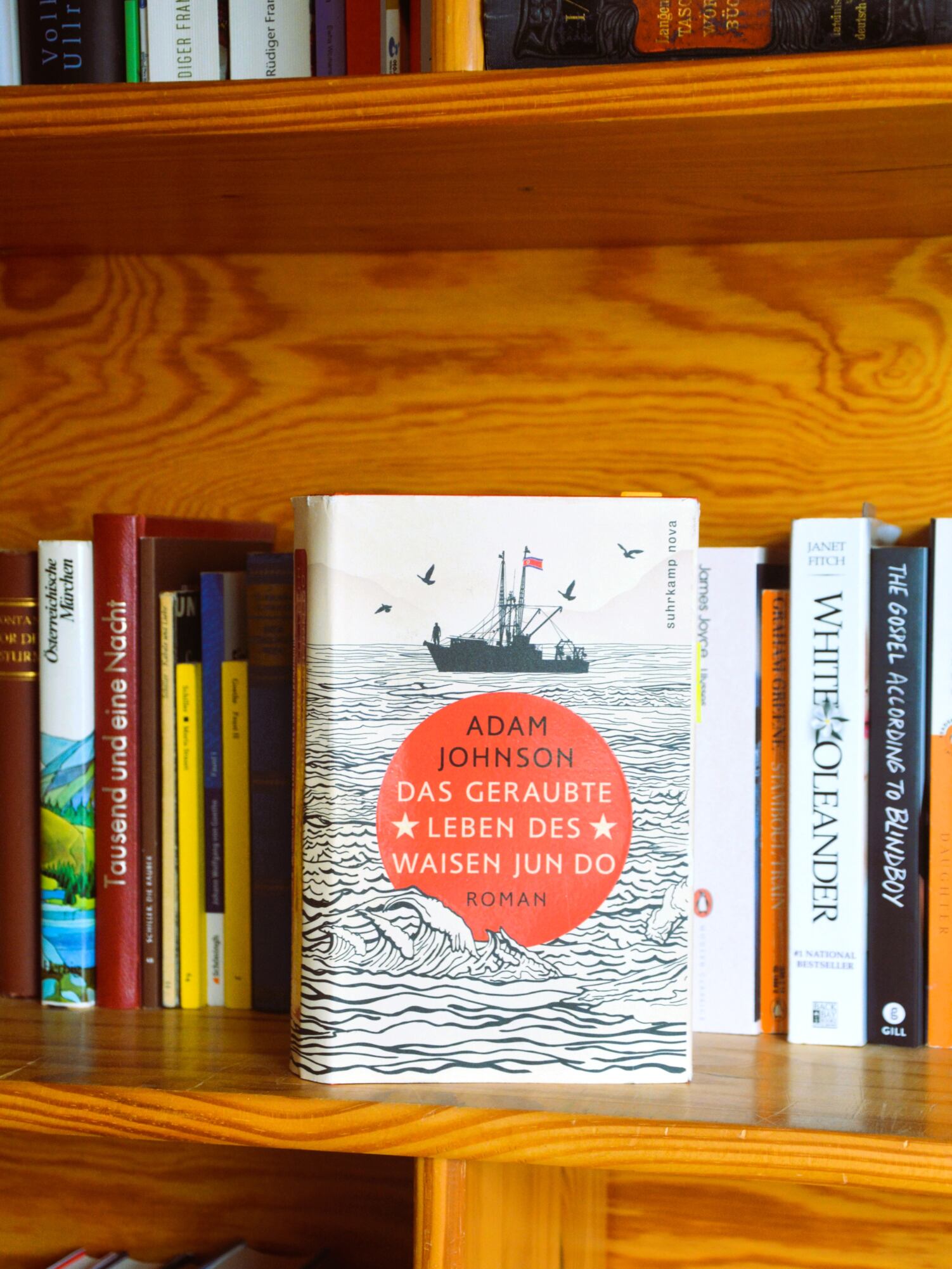
In diesem Stil wird man vom US-amerikanischen Autor Adam Johnson zu Beginn seines 2012 erschienen Romans The Orphan Master's Son plötzlich in den fremden und unglaublich verstörenden Alltag in Nordkorea geworfen. Das Buch – eine überraschend stimmige Melange aus Spionage-Thriller, aufopfernder Liebesgeschichte und politischer Satire – entstand, nachdem Johnson 2007 selbst in die Demokratische Volksrepublik Nordkorea reiste. Dort bekam er die Möglichkeit, zumindest den für TouristInnen aufrechterhaltenen Schein nordkoreanischer Lebensrealität zu beobachten¹. 2013 wurde der fast 700-seitige Roman unter dem Titel Das geraubte Leben des Waisen Jun Do im Suhrkamp Verlag Berlin auch im Deutschen veröffentlicht. Vor dem Hintergrund mehrerer nuklearer Drohungen Nordkoreas und der daraus neu aufflammenden Spannungen mit den USA², gewann Johnson für seinen Roman im selben Jahr den Pulitzer-Preis³.
Die Geschichte beginnt während der Hungersnot oder des Beschwerlichen Weges, wie die Zeit von 1994 – 1998 in Nordkorea genannt wird, und nimmt in der Regierungszeit von Kim Jong-il (1994 – 2011) seinen weiteren Verlauf. In diesen Zeiten schickt der Autor seinen Helden Jun Do, ein „Junge aus Nirgendwo" (S. 569) aufgewachsen in einem Waisenhaus, auf eine Odyssee. Im Gegensatz zum bekannten griechischen Irrfahrer begibt Jun Do sich jedoch auf diese Reise, ohne ein Zuhause oder eine Familie zu haben, zu der er je zurückkehren könnte. Zunächst lernen wir Jun Do im ersten Teil des Buches als Kind, als Komplize bei Entführungen, als Berichterstatter auf Hoher See und als geheimen Agenten auf Reisen kennen. Im zweiten Teil des Buches erscheint Jun Do schließlich als ein von den Erfahrungen und Werten seines Vorlebens geprägter Kommandant.
Johnson vermag es im Buch mit treffender Symbolik mehr zu vermitteln, als die Geschichte selbst preisgibt. So ist der Name des Helden Jun Do sicher nicht zufällig ein Klangvetter des englischen John Doe, ein Platzhaltername für entweder fiktive oder nicht identifizierte Personen. Die Frage nach dem Namen und der Identität zieht sich durch den ganzen Roman. Jun Do wird nicht benannt, sondern er sucht sich seinen Namen selbst aus der Liste der 114 großen Märtyrern der Revolution aus. Von Beginn an wird Jun Do seines Lebens und seiner Identität immer wieder durch unkontrollierbare Umstände buchstäblich beraubt. Wie ihm erklärt wird, ist dies in Nordkorea völlig normal: „Wo wir herkommen, sind Geschichten Realität […] Wenn ein Mann nicht zu seiner Geschichte passt, dann ist es der Mann, der sich ändern muss." (S. 192), und nicht wie in Amerika, wo der Mann zählt und seine Geschichte ständig ändern kann.
Ein weiterer gelungener Aspekt des Romans ist die Gegenüberstellung der Gesellschaftsordnungen in den USA und in Nordkorea. Dabei greift der Autor gern zu nicht unwahren Übertreibungen und ein weiteres Mal zum Symbol. Er nutzt zum Beispiel die Figur des Hundes als Vergleichspunkt. In Nordkorea gelten Hunde als minderwertige Lebewesen: Sie werden verspeist, als abstoßend empfunden und oft als dreckige, wilde und gefährliche Bestien dargestellt. Nicht selten werden sie misshandelt und geschlagen. In den USA und hierzulande gilt der Hund als eines der intelligentesten Säugetiere, als Freund und Familienmitglied, als erzogen und lieb aufs Kommando hörend, vor allem, wenn ein Leckerli auf ihn wartet. Jun Do erhält die Möglichkeit beide Hundebetrachtungen zu beobachten und zieht schließlich einen Vergleich zwischen Hunden (oder Menschen?) im nordkoreanischen Kommunismus und im amerikanischen Kapitalismus: „Offensichtlich, dachte Jun Do, prügelte der Kommunismus seine Hunde zum Gehorsam, während der Kapitalismus dasselbe Ziel mit Bestechung erreichte." (S. 214) Dies ist nur eine der zahlreichen Erkenntnisse Jun Dos, für die Johnson an nordkoreanisches Realitätsverständnis eine westliche Skala anlegt und somit Lesenden ein besseres Verständnis für jene nordkoreanische Realität vermittelt.
Durch den Roman stellt und beantwortet der Autor viele bedeutende, teils philosophische Fragen des Lebens im Kontext eines Landes, in dem die meisten Menschen nicht den Luxus besitzen, diese Fragen zu betrachten. Was bedeutet es, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen, welches vielleicht moralisch fragwürdig, aber lebensnotwendig ist? Was ist der Sinn dieser Taten, wenn man sie außerhalb Nordkoreas betrachten würde? Was bedeutet es, zu vertrauen? Und was bedeutet es, zu lieben? Wissen NordkoreanerInnen, was Freiheit ist? Gibt es eine allgemeingültige Definition von Freiheit?
Wenn wir Jun Do fragen würden, gäbe er zur Antwort, Freiheit sei „wenn er sich als Junge eine Stunde lang von den Hochöfen davongestohlen hatte und mit den anderen Kindern in den Schlackehaufen herumgeklettert war, obwohl überall Wachen standen, ja gerade weil überall Wachen standen – das war Freiheit in ihrer reinsten Form." (S. 243) Unser Verständnis von Freiheit ist subjektiv gemessen an den greifbaren und abstrakten Grenzen, in denen wir Leben. Sie besteht für uns in dem Moment, indem wir diese uns vertrauten Grenzen überschreiten können, ohne dabei behindert zu werden. Die Größe des Raumes innerhalb der Grenzen spielt für einzelne dabei weniger eine Rolle, als dass was sie außerhalb der Grenzen erwartet.
Auch sprachlich überzeugt der Roman (aus dem amerikanischen übertragen von Anke Caroline Burger). Johnsons Formulierungen und Satzstrukturen sind oft lang, aber fließend und werden von prägnanten Sätzen unterbrochen, die mehr sagen, als es viele Worte könnten. Ein Beispiel hierfür ist die detaillierte Beschreibung einer Krankenstube und des einzigen Patienten, die schließlich im Satz „Einen Arzt gab es nicht." (S. 29) endet. Zum einen ist Johnsons Sprache direkt, manchmal sogar brutal und nimmt kein Blatt vor den Mund. Zum anderen beschreibt er mit Hilfe von Jun Dos Augen Szenen sehr detailreich, um den Lesenden ein möglichst ausgefülltes Bild nordkoreanischer Umstände zu zeichnen.
Die Handlung um das Alltagsleben Jun Dos wird außerdem, ähnlich wie das reale Leben der NordkoreanerInnen, immer wieder von Kampagnen-Kapiteln unterbrochen. Diese Buchkapitel stellen die ständigen Lautsprecher-Übertragungen in Nordkorea dar und spiegeln im Buch in reinster Propagandasprache die Sicht des Regimes auf die Geschichte Jun Dos wider. Der Inhalt dieser Kampagnen strotzt nur so von Pathos, Absurditäten und versteckten Wahrheiten, dass man oft nicht anders kann, als ungläubig über den dunklen Humor und die satirischen Über- und Untertreibungen zu lachen.
Das Buch ist historische Zeitkapsel, dramatische Theaterbühne und politisches Regimemodell zugleich. Inhaltlich und auch sprachlich gewährt es detaillierte Einblicke in das Leiden und Leben in Nordkorea in den 1990er und 2000er Jahren. Diese sind hochinteressant und authentisch, vor allem, da sie auf den eigenen Erfahrungen des Autors und denen von nordkoreanischen Geflüchteten basieren. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es sich um einen Roman, eine fiktive Erzählung aus der Feder einer einzelnen Person handelt. Die Grenzen zwischen wahren Begebenheiten und Fiktion sind stark verwischt, wobei Eckpunkte in nordkoreanischer Geschichte, wie die große Hungersnot in den 1990er Jahren und die Entführungen von japanischen StaatsbürgerInnen, dem Roman eine Zeitlinie geben. Manchmal sorgte diese Verwischung für Verwirrung über Wahrheit und künstlerische Freiheit. Viele der beschriebenen Szenen entsprechen mit Sicherheit wahren Begebenheiten und Zuständen, jedoch bleibt das Leben Jun Dos als Ganzes eine ausgedachte Geschichte.
Außerdem hilft es für das vollständige Verständnis des Romans und der Lebenssituation Jun Dos, über Kenntnisse zum nordkoreanischen Regime im Wandel der Zeiten zu verfügen. Dies bezieht sich vor allem auf die oft verwendete Symbolik, als auch auf die satirischen Elemente im Buch, die ohne Hintergrundwissen nur bruchteilhaft zu verstehen sind.
Das geraubte Leben des Waisen Jun Do ist ein literarisches Meisterwerk. Johnson lädt die Lesenden zu einer Zeitreise aus der Sicht einer einzelnen nordkoreanischen Person ein, die im Laufe des Romans mehrere menschliche Schicksale komprimiert in einem Leben zu leben scheint, oder wie Jun Do es selbst ausdrückt: „Meine Geschichte hat schon zehn Mal geendet und hört doch nie auf." (S. 631). Der Autor schafft dabei das erschreckende Abbild eines zutiefst menschenfeindlichen Regimes. Es ist für alle zu empfehlen, die sich bereits etwas mit Nordkorea auskennen und faktisches Wissen durch Johnsons literarisches Talent zum Leben erweckt lesen wollen. Trotzdem stellt es auch für NichtkennerInnen eine empfehlenswerte Lektüre dar, denn es gibt Anreiz für eine weitere Beschäftigung mit Themen, wie vergangene und aktuelle Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea oder den Strukturen dieses totalitären Staates im 21. Jahrhundert. Außerdem vermag die Geschichte es Empathie und Solidarität mit den Schicksalen nordkoreanischer Menschen zu schaffen. Menschen wie Jun Do, die es wagen, sich nicht selbst ändern zu lassen, sondern ihre eigene Geschichte zu lenken.





