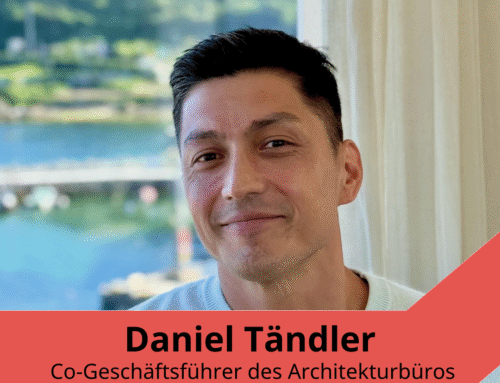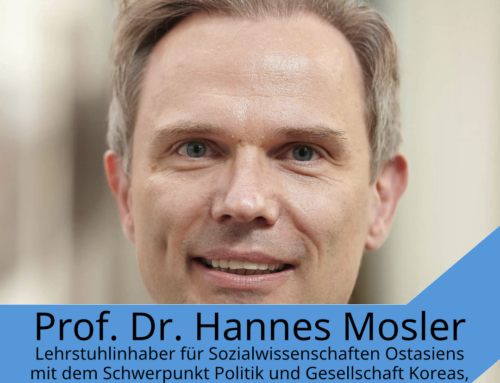Die Fragen stellte die Arbeitsgruppe „10 Fragen an“ des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea.
Hinweis: Die Äußerungen unserer Interviewpartner stellen deren Meinung dar und spiegeln nicht grundsätzlich die Meinung des Deutsch Koreanischen Forums e.V. oder des Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea wider.
- Was hat Ihr Interesse an computergestützte Sozialwissenschaften unter Einsatz von Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz geweckt?
Ich interessiere mich für computergestützte Sozialwissenschaften unter Verwendung von Datenwissenschaften und künstlicher Intelligenz, weil Daten verschiedene Verhaltensmuster von Menschen enthalten. Durch die Analyse dieser Muster mit Hilfe von Datenwissenschaften, können neue gesellschaftliche Phänomene und Verhaltensmuster entdeckt werden.
Unser Forschungsteam heißt „Data Science for Humanity“ und wir hoffen, dass jedes unserer Forschungsprojekte zum Nutzen der Gesellschaft beitragen wird. In diesem Sinne interessieren wir uns für den gesamten Prozess des Umgangs mit Daten – die Menschen und die Gesellschaft enthalten – für die Entwicklung von Analysemethoden der künstlichen Intelligenz, um sie effektiver zu analysieren, sowie für die Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Bereichen – einschließlich Wirtschaft und Soziologie – um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
- Welche neuen Trends gibt es in diesen beiden Bereichen, und wie unterscheiden sich diese Trends in Korea und Deutschland?
Da künstliche Intelligenz (KI) inzwischen sämtliche Aspekte unseres Lebens durchdringt, wächst das Interesse an den Auswirkungen von KI auf das Leben der Menschen, am Bewusstsein für KI und an der komplementären Beziehung zwischen Menschen und KI. Dieses Interesse teilen sich sowohl Südkorea als auch Deutschland.
In Deutschland liegt der Schwerpunkt jedoch stärker auf der Standardisierung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von KI, während in Südkorea der technologische Fortschritt und das dadurch ermöglichte Wirtschaftswachstum im Mittelpunkt der Diskussion über schnelle KI stehen. Trotz ihrer unterschiedlichen Herangehensweise haben beide Länder das gemeinsame Ziel, durch KI eine bessere Zukunft zu gestalten.
- Sie forschen aktiv in Korea und Deutschland. Was sind die Hauptunterschiede zwischen den beiden Ländern, und was können sie voneinander lernen?
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) und IBS (Institute for Basic Science) sind zwei der besten Forschungseinrichtungen in Korea. Ebenso außergewöhnlich ist die Forschungsförderung am Max-Planck-Institut (MPI) in Deutschland, an dem ich nun angefangen habe zu arbeiten. Hier bekommt man genügend Zeit und ausreichend Unterstützung, um kreative Forschung zu betreiben, ohne dabei die Forschungsprojekte erklären zu müssen.
Ich bin erst seit ein paar Monaten in Deutschland und werde sicher noch mehr Zeit brauchen, um mich mit den Unterschieden vertraut zu machen. Aber alle Einrichtungen, denen ich angehöre, sind geprägt von der Vision und Leidenschaft von herausragenden Wissenschaftler*innen, und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich selbst noch viel lernen kann.
- Denken Sie, dass sich der Umgang mit Fake News und sozialen Medien in Korea und Deutschland stark unterscheidet? Falls ja, wie?
Um dieses Problem anzugehen, ist es zunächst wichtig, klare Definitionen festzulegen. Misinformation (Fehlinformation) bedeutet einfach falsche Informationen, während Mis-leading Information (irreführende Informationen) zwar auf einigen Fakten basiert, aber absichtlich verzerrt sind, um die Menschen in die Irre zu führen. Fake News sind Nachrichten, die das Format eines Nachrichtenberichts übernehmen, obwohl sie nicht von einer anerkannten Medienquelle stammen, oder Fehlinformationen enthalten.
Mis-leading Information verursachen nicht nur in Südkorea und Deutschland, sondern weltweit große soziale Probleme. Daher ist es sehr wichtig, sie zu erkennen und darauf zu reagieren. In den letzten Jahren haben sich Fehlinformationen über nationale Grenzen hinweg verbreitet, und es sind auch neue Trends entstanden, vor allem die kognitive Kriegsführung (cognitve warfare), die die Verbreitung von Mis-leading Information und die Einmischung in die Politik anderer Länder beinhaltet. Zu den Unterschieden gehören die wichtigsten verwendeten Plattformen und die Interessen der Nutzer in den verschiedenen Ländern, was zu unterschiedlichen Mustern, Wegen und Themen der Fehlinformationen führen kann. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen und darauf zu reagieren.
- Während der COVID-19-Pandemie haben Sie Fake News über das Virus untersucht. Welche Hauptresultate brachte diese Forschung?
Als Wissenschaftlerin, die sich mit der Verbreitung von Informationen in sozialen Medien beschäftigt, war ich während der Pandemie besonders an der Entstehung und Verbreitung von Fake News interessiert. Die Kampagne „Facts Before Rumors“ (https://ibs.re.kr/fbr) wurde entwickelt, um Fehlinformationen proaktiv entgegenzuwirken. Dabei nutzt die Forschung die zeitlichen und geografischen Unterschiede bei der Verbreitung von Gerüchten über das Virus in Ländern, die zuerst von Covid-19 betroffen waren, wie China und Südkorea, und die sich dann nacheinander in anderen Ländern ausbreiten. Unser Forschungsteam sammelte rund 200 Gerüchte aus Asien und fasste diese in 15 Schlüsselbotschaften zusammen, die für die öffentliche Gesundheit relevant waren. Diese übersetzten wir in Infografiken in mehr als 20 Sprachen und vermittelten sie zusammen mit einer Sammlung von Faktenchecks an mehr als 151 Länder.
Wir haben viel aus der Kampagne gelernt und es gibt ein paar wichtige Erkenntnisse: Erstens ist proaktives Faktenchecken während einer Gesundheitskrise effektiv. Menschen, die die Botschaft der Kampagne sahen, ließen sich seltener durch nachfolgende Gerüchte täuschen und waren eher bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Diejenigen, die den Gerüchten bereits Glauben schenkten, standen dem Impfstoff eher misstrauisch gegenüber. Zweitens müssen bei der der Bekämpfung der „Infodemien” die wirtschaftlichen Bedingungen der einzelnen Länder berücksichtigt werden. Fehlinformationen waren in einkommensschwachen Ländern mit schwacher Infrastruktur und größeren Auswirkungen des Virus weiterverbreitet. Daher ist es besonders wichtig, proaktive Faktenchecks in diesen Ländern in der jeweiligen Landessprache breizustellen.
- Wie kann internationale Zusammenarbeit (z. B. durch politische Maßnahmen oder Foren) helfen, Fake News zu bekämpfen?
Internationale Kooperation ist unerlässlich, um Fake News zu bekämpfen. Die Zusammenarbeit mehrerer Länder bei der Bereitstellung von Faktencheck-Materialien in mehreren Sprachen während Covid-19 zeigt, wie wichtig die soziale und technische Zusammenarbeit auf globaler Ebene ist. In den letzten Jahren haben sich Fake News über nationale Grenzen hinweg verbreitet und wichtige gesellschaftliche Entscheidungen sowie die Politik beeinflusst. Dies hat die Form einer kognitiven Kriegsführung (cognitive warfare) angenommen, wodurch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit noch wichtiger wurde.
Indem mehrere Länder gleichzeitig Fake News gegenprüfen, können der Öffentlichkeit genauere Informationen geliefert werden. Darüber hinaus genießen offizielle Informationen, die durch internationale Zusammenarbeit bereitgestellt werden, ein größeres Vertrauen der Öffentlichkeit. Eine solche Zusammenarbeit trägt wesentlich zur Bekämpfung des Problems der Fake News bei.
- Welche Sorgen haben Sie in Bezug auf Fake News oder ähnliche Themen in der heutigen Gesellschaft?
Durch die Fortschritte bei generativen KI-Modellen wird es immer einfacher, Fake News zu erstellen. Das wiederum erfordert eine angemessene Regulierung und die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Auswirkungen der KI-Nutzung unverzichtbar. Die Möglichkeit, mithilfe generativer KI schnell und einfach Inhalte zu erstellen, erhöht auch das Risiko der Verbreitung irreführenden Informationen.
Besonders problematisch ist dabei das Thema „Deepfake“, welches in Südkorea zuletzt für Aufsehen sorgte. Solche Inhalte können soziale Konflikte und Misstrauen verschärfen und die gesellschaftliche Polarisierung verstärken. Daher müssen soziale Verantwortung und Regulierung den Fortschritt der KI-Technologie begleiten, um dieses Problem zu bewältigen.
- Wie waren Ihre Erfahrungen als Frau in der Wissenschaft, insbesondere in Korea und Deutschland?
Als Frau in der Wissenschaft – und in jedem anderen Bereich – ist es wichtig, Unterstützung von der Umgebung zu erhalten, um sich beruflich zu etablieren. Beispielsweise muss man bei der Teilnahme an wichtigen Konferenzen die Kinderbetreuung organisieren, was sowohl in Korea als auch in Deutschland der Fall ist. Allerdings habe ich das Gefühl, dass in Deutschland mehr Wert auf Chancengleichheit im Einstellungsprozess gelegt wird.
- Haben Sie Ratschläge für junge Menschen, die eine Karriere in den Bereichen Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz anstreben?
Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz sind beides sehr schnelllebige Bereiche, und es ist wichtig, dass man seinen Horizont offenhält, um sich an diese Veränderungen anzupassen. Obwohl sich die Technologien schnell verändern, bleiben Mathematik und die Neugier auf den Menschen als Kernbestandteile unverändert.
Auch gesellschaftliches Interesse und Verständnis sind notwendig. Wer sich mit wichtigen sozialen Themen beschäftigt und diese mit Daten analysiert, hat dadurch die Möglichkeit Probleme in der Realität zu lösen. Wenn man über die Auswirkungen der eigenen Forschung auf die Gesellschaft nachdenkt, kann das der Schlüssel zu einer nützlichen und verantwortungsvollen Technologie sein.
- Wie haben Sie vom Deutsch-Koreanischen Forum erfahren, und was war der eindrucksvollste Moment beim diesjährigen Forum?
Es war das erste Mal, dass ich zu diesem Forum eingeladen wurde, und es war in jeder Hinsicht eine bewegende Veranstaltung: die Plenarsitzungen, die thematischen Diskussionen, das Juniorforum bis hin zum Abendessen. Ich hoffe, dass durch den Austausch zwischen den beiden Ländern viele junge Menschen die Gelegenheit bekommen, miteinander in Kontakt zu kommen.